- Darmgesundheit und Verdauung entscheiden maßgeblich über das Wohlbefinden des Menschen.
- Der ''World Digestive Health Day'' am 29. Mai schärft das Bewusstsein dafür, aktiv etwas für die Darmgesundheit zu tun.
- Bei Patient:innen mit starken chronischen Schmerzen kann eine opioidinduzierte Obstipation (OIC) die Lebensqualität stark beeinträchtigen.
Bad Homburg v. d. Höhe, 28. Mai 2025 — Ein gesunder Darm und eine geregelte Verdauung entscheiden maßgeblich über das Wohlbefinden des Menschen. Aus diesem Grund begeht der Weltverband für Gastroenterologie – die World Gastroenterology Organisation, kurz WGO –alljährlich am 29. Mai den Welttag der Verdauungsgesundheit (World Digestive Health Day/WDHD). In diesem Jahr steht er unter dem Motto ''Your Digestive Health: Nourish to Flourish''; sinngemäß „Die Gesundheit deiner Verdauung: Sich gut ernähren, um aufzublühen“1 (siehe primäre Abbildung/Abbildung 1). Der dahinterstehende Gedanke: Eine gesunde Verdauung hält nicht nur die körperliche Fitness, sondern auch das mentale und emotionale Befinden im Gleichgewicht. Mit einer ausgewogenen Ernährung, ausreichender Flüssigkeitsaufnahme, Bewegung und einem achtsamen Essverhalten kann jeder Mensch selbst viel zu einer gesunden Verdauung beitragen. Doch nicht immer hat er oder sie es selbst in der Hand – wenn etwa Medikamente wie Opioide das Gleichgewicht aus dem Lot bringen und Obstipation den Betroffenen zu schaffen macht.
Obstipation kann vielfältige Ursachen haben
Die WGO begeht den WDHD alljährlich mit einer weltweiten Kampagne, um das Bewusstsein für Prävention, Prävalenz, Diagnose, Management und Behandlung von Erkrankungen und Störungen des Verdauungssystems zu schärfen. Unter ihnen ist etwa das Reizdarmsyndrom von hoher Relevanz – und ein häufiger Grund, weshalb Betroffene ärztlichen Rat suchen.2 Weltweit beträgt die geschätzte Prävalenz im Mittel 11,2 %. Bei der Obstipation als Zeichen einer schlechten Verdauungsgesundheit ist in Europa in der Gesamtbevölkerung von einer mittleren Prävalenz von ca. 15 % auszugehen.3 Bei Frauen und älteren Menschen ist sie noch deutlich höher. „Die für die Betroffenen oft sehr quälende Obstipation kann vielfältige Ursachen haben – etwa Grunderkrankungen wie eine Hypothyreose, funktionelle Obstipation und Obstipation beim Reizdarmsyndrom oder schwere Motilitätsstörungen. Auch verschiedene Medikamente etwa aus der Gruppe der Diuretika oder Antidepressiva und vor allem der Opioide können eine Obstipation verursachen“, erläutert Prof. Dr. med. Martin Storr, Zentrum für Endoskopie, Gastroenterologische Praxis, Starnberg.
Patient:innen über OIC als mögliche Nebenwirkung der Opioide aufklären
Hinsichtlich des Einsatzes von Analgetika sind nach Angaben im BVSD-Weißbuch Schmerzmedizin 2024 des Berufsverbandes der Ärzte und Psychologischen Psychotherapeuten in der Schmerz- und Palliativmedizin in Deutschland (BVSD) e. V. etwa 23 % der in Deutschland lebenden Menschen von chronischen Schmerzen betroffen.4 Wird zur Behandlung starker chronischer Schmerzen ein Opioid verordnet, sollten Ärzt:innen ihre Patient:innen bei Therapiebeginn grundsätzlich auf die opioidinduzierte Obstipation (Opioid-Induced Constipation/OIC) als mögliche Nebenwirkung hinweisen.5 Laut Praxisleitlinie opioidinduzierte Obstipation der Deutschen Gesellschaft für Schmerzmedizin (DGS) e. V. entwickeln 15–81 % der mit Opioiden behandelten Patient:innen mit chronischen nicht-tumorbedingten Schmerzen und 74–87 % der Patient:innen mit tumorbedingten Schmerzen eine OIC.6 Die möglichen Folgen: Im Rahmen einer in Europa und den USA durchgeführten Befragung gab eine:r von drei Patient:innen an, die Opioiddosis zur Erleichterung des Stuhlgangs reduziert oder das Opioid sogar ganz abgesetzt zu haben.7 Eine OIC kann somit den Erfolg der Opioidtherapie gefährden. Trotz Einnahme von Laxanzien hatte die Obstipation bei den meisten Patient:innen zumindest einen moderaten negativen Einfluss auf die Lebensqualität und die Aktivitäten des täglichen Lebens. Im Rahmen eines Surveys berichteten 94 % der Patient:innen mit nicht-tumorbedingten chronischen Schmerzen und OIC, auf das zuerst eingenommene Laxans nur unzureichend angesprochen zu haben.8
Leitlinienempfehlungen bei chronischer Obstipation
Als Allgemeinmaßnahmen zum Management der Obstipation empfiehlt die S2k-Leitlinie chronische Obstipation, auf eine tägliche Trinkmenge von 1,5–2 l zu achten und körperliche Inaktivität zu vermeiden.3,2 Bei adipösen Patient:innen kann auch eine gesteigerte körperliche Aktivität sinnvoll sein. Da Ballaststoffe die Stuhlfrequenz erhöhen können, sollte bei gegebener Verträglichkeit eine Aufnahme von 30 g täglich angestrebt werden. Bei funktioneller chronischer Obstipation können auch Probiotika, Präbiotika und Synbiotika (darmmikrobiombeeinflussende Substanzen) versucht werden. Sind diese Basismaßnahmen nicht ausreichend effektiv, sollten Laxanzien gegeben werden. Mittel der ersten Wahl sind osmotisch wirksame Macrogole und die stimulierenden Laxanzien Natriumpicosulfat und Bisacodyl. Daneben können Anthrachinone erwogen werden. Dosierung und Einnahmefrequenz richten sich bei allen Präparaten nach dem individuellen Bedarf. Unter den rektalen Entleerungshilfen sind Bisacodyl-Zäpfchen oder CO2 freisetzende Zäpfchen zu bevorzugen.
Normalisierung der Darmfunktion durch ursachenorientierte Therapie
Die OIC unterscheidet sich von anderen Formen der Verstopfung, da ihre Ursache die Bindung der Opioide an µ-Opioid-Rezeptoren des Gastrointestinaltraktes ist. Dadurch werden unter anderem die Magen-Darm-Beweglichkeit und die Sekretion im Magen-Darm-Trakt beeinträchtigt und es kommt zur Funktionsstörung des Darms.9 Laxanzien können auch bei der durch Opioide verursachten Obstipation eingesetzt werden. Die der OIC zugrunde liegende Pathophysiologie beeinflussen sie aber nicht.3 Bei unzureichendem Ansprechen auf Laxanzien stehen mit den peripher wirkenden Opioid-Rezeptorantagonisten (Peripherally Acting μ-Opioid Receptor Antagonists/PAMORAs) hochspezifische Substanzen zur Verfügung, um ursächlich gegen die OIC vorzugehen.6 Indem sie die peripheren µ-Opioid-Rezeptoren im Gastrointestinaltrakt selektiv blockieren, verhindern sie die Bindung der Opioide im Darm und tragen so zur Normalisierung der Darmfunktion bei.10 Der gewünschte analgetische Effekt der Opioide im zentralen Nervensystem (ZNS) wird nicht beeinträchtigt, da die PAMORAs nicht bluthirnschrankengängig sind.11 Dies wurde mit klinischen Daten der Zulassungsstudien dokumentiert.12,13 Durch die anhaltende Wirksamkeit sind PAMORAs zur Dauertherapie der OIC geeignet, und die Kombination mit einem Laxans oder einem Prokinetikum ist möglich.
Schmerzpatient:innen frühzeitig auf Obstipation untersuchen
In der S2k-Leitlinie chronische Obstipation werden auf Stufe 1 des Therapieschemas auch bei OIC Laxanzien wie Macrogol, Bisacodyl oder Natriumpicosulfat empfohlen.3 Auf Stufe 2 (als Monotherapie) und Stufe 3 (in Kombination mit Laxanzien) werden dann auch PAMORAs als Therapieoption empfohlen. Ein von europäischen Expert:innen erarbeitetes Konsensuspapier empfiehlt PAMORAs ebenfalls auf Stufe 2 nach Laxanzien.14 Der Praxisleitfaden einer italienischen Expert:innengruppe sieht vor, Patient:innen innerhalb der zweiten Woche nach Verordnung eines Opioids auf eine OIC hin zu untersuchen.5 Liegt eine solche trotz Gabe eines Laxans vor, sollte ein PAMORA verordnet werden.
Über die World Gastroenterology Organisation (WGO)
Der Weltverband für Gastroenterologie (WGO) ist ein Zusammenschluss von über 100 Mitgliedsgesellschaften aus den Bereichen Gastroenterologie, Hepatologie, Endoskopie und anderen verwandten Disziplinen, die weltweit über 60.000 Personen vertreten. Das Ziel der WGO ist die Förderung des Bewusstseins für die weltweite Prävalenz und die optimale Versorgung von Magen-Darm- und Lebererkrankungen in der breiten Öffentlichkeit und bei den Angehörigen der Gesundheitsberufe sowie die Verbesserung der Versorgung bei diesen Erkrankungen durch qualitativ hochwertige und leicht zugängliche Aus- und Fortbildung und Interessenvertretung.
Die WGO geht auf die Initiative von Georges Brohée (1887-1957) zurück. Der belgische Chirurg und Radiologe förderte die moderne Gastroenterologie, insbesondere durch die Gründung der Belgischen Gesellschaft für Gastroenterologie im Jahr 1928 und die Organisation des ersten internationalen Gastroenterologiekongresses in Brüssel im Jahr 1935. Seine kontinuierlichen Bemühungen gipfelten in der Gründung der „Organisation Mondiale de Gastroentérologie“ (OMGE) am 29. Mai 1958 in Washington, D.C., USA, wo der erste Weltkongress für Gastroenterologie stattfand. Der erste Präsident war Dr. Henry L. Bockus, dessen Vision es war, die Standards der Aus- und Weiterbildung in der Gastroenterologie zu verbessern. Im Mai 2007 wurde die Organisation offiziell in World Gastroenterology Organisation (WGO) umbenannt.15
Über Viatris
Viatris Inc. (NASDAQ: VTRS) ist ein weltweit tätiges Gesundheitsunternehmen, das Menschen weltweit befähigt, in jeder Lebensphase gesünder zu leben. Durch unser einzigartiges Global Healthcare Gateway® bieten wir Zugang zu Arzneimitteln und Impfstoffen sowie auch neu entwickelten Biosimilars, fördern wir eine nachhaltige Unternehmensführung, entwickeln innovative Lösungen und nutzen unsere Kompetenz, um mehr Menschen den Zugang zu mehr Produkten und Dienstleistungen zu ermöglichen.
Viatris, das im November 2020 entstand, vereint erstklassige Expertise in den Bereichen Wissenschaft, Produktion und Vertrieb mit bewährten regulatorischen, medizinischen und kommerziellen Fähigkeiten, um Patienten qualitativ hochwertige Medikamente in mehr als 165 Ländern und Territorien zu liefern. Das weltweite Portfolio von Viatris umfasst mehr als 1.400 Moleküle für ein breites Spektrum von Therapiegebieten, die sowohl nicht übertragbare als auch Infektionskrankheiten abdecken, sowie erstklassige, bekannte Markenprodukte und globale Schlüsselmarken, Generika – inklusive Marken- und komplexe Generika – und eine Vielzahl von Präparaten zur Selbstmedikation/OTC-Produkten. Mit weltweit rund 37.000 Mitarbeitenden haben wir unseren Hauptsitz in den USA und globale Zentralen in Pittsburgh (USA), Shanghai (China) und Hyderabad (Indien). Weitere Informationen finden Sie auf https://www.viatris.com/en und https://investor.viatris.com. Bleiben Sie auch über Twitter @ViatrisInc, LinkedIn und YouTube mit uns in Verbindung.
Zur Viatris-Gruppe Deutschland gehören die pharmazeutischen Unternehmer Mylan Germany GmbH, Viatris Healthcare GmbH, Viatris Pharma GmbH sowie MEDA Pharma GmbH & Co. KG am Standort in Bad Homburg v. d. Höhe (Deutschlandzentrale) und als Produktionsstätte die Madaus GmbH in Troisdorf (bei Köln). Das Portfolio umfasst in Deutschland mehr als 400 Produkte, darunter Originale und (Marken-) Generika. Sowohl verschreibungspflichtige als auch rezeptfreie Präparate decken ein breites Spektrum an Therapiegebieten ab. Hervorzuheben sind insbesondere Antithrombotika und Impfstoffe (Influenza). Weiterführende Informationen unter: www.viatris.de.
Bildmaterial
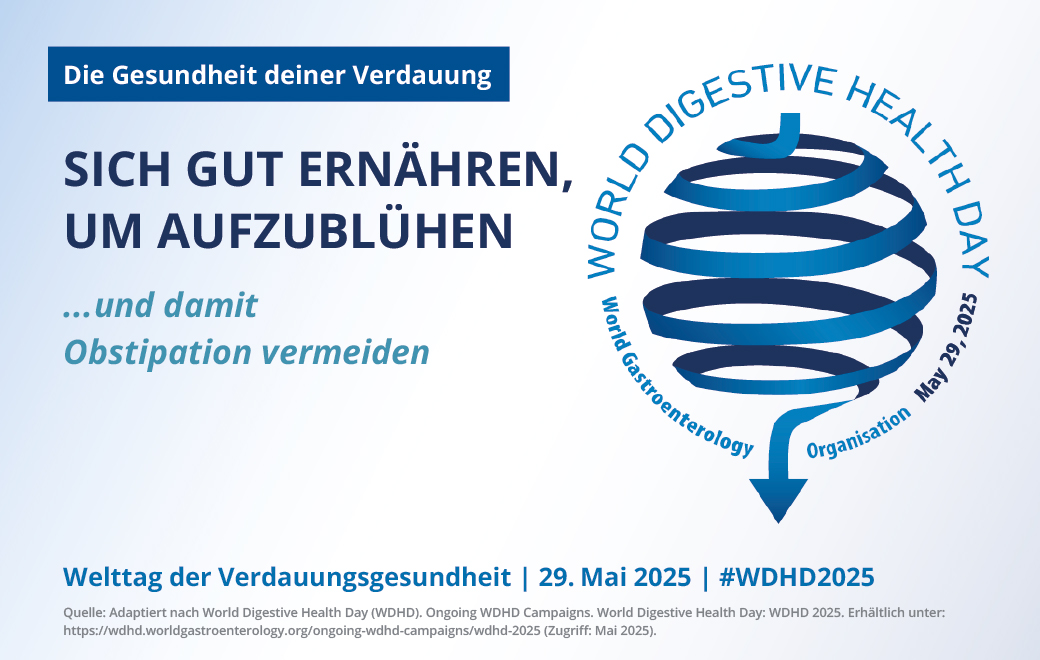
Primäre Abb./Abb. 1: Der diesjährige Welttag der Verdauungsgesundheit (World Digestive Health Day/WDHD) hat das Motto ''Your Digestive Health: Nourish to Flourish''. Dies verdeutlicht: Eine gesunde Verdauung hält nicht nur das körperliche, sondern auch das geistige und seelische Befinden im Gleichgewicht. Damit kann Obstipation vermieden werden. © Viatris-Gruppe Deutschland
###
Druckfähiges Bildmaterial anbei.
Für Rückfragen und weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Pressestelle Viatris-Gruppe Deutschland
+49 (0) 6172 - 888 - 1234
Presse-DE@viatris.com
___________________________________________________
1 World Digestive Health Day (WDHD). https://wdhd.worldgastroenterology.org/ongoing-wdhd-campaigns/wdhd-2025
(Zugriff: Mai 2025).
2 Layer, P et al. (2021) Update S3-Leitlinie Reizdarmsyndrom: Definition, Pathophysiologie, Diagnostik und Therapie. Gemeinsame Leitlinie der Deutschen Gesellschaft für Gastroenterologie, Verdauungs- und Stoffwechselkrankheiten (DGVS) und der Deutschen Gesellschaft für Neurogastroenterologie und Motilität (DGNM). Erhältlich unter: https://register.awmf.org/assets/guidelines/021-016l_S3_Definition-Pathophysiologie-Diagnostik-Therapie-Reizdarmsyndroms_2022-02.pdf (Zugriff: Mai 2025).
3 Andresen, V et al. (2022). Aktualisierte S2k-Leitlinie chronische Obstipation der Deutschen Gesellschaft für Gastroenterologie, Verdauungs- und Stoffwechselkrankheiten (DGVS) und der Deutschen Gesellschaft für Neurogastroenterologie & Motilität (DGNM). Erhältlich unter: https://register.awmf.org/assets/guidelines/021-019l_S2k_Chronische_Obstipation_2022-11.pdf (Zugriff: Mai 2025).
4 Berufsverband der Ärzte und Psychologischen Psychotherapeuten in der Schmerz- und Palliativmedizin in Deutschland – BVSD e.V.: BVSD-Weißbuch Schmerzmedizin 2024. Erhältlich unter: https://www.bvsd.de/wp-content/uploads/2024/09/BVSD-Weissbuch-2024_final.pdf (Zugriff: Mai 2025).
5 Varrassi, G et al. (2024). Improving Diagnosis and Management of Opioid-Induced Constipation (OIC) in Clinical Practice: An Italian Expert Opinion. Journal of Clinical Medicine; 13(22):6689.
6 Überall, M A (verantwortlicher Leitlinienautor) (2019). Deutsche Gesellschaft für Schmerzmedizin. DGS-PraxisLeitlinien Schmerztherapie. Opioidinduzierte Obstipation V2.0. für Fachkreise. Erhältlich unter: https://dgs-praxisleitlinien.de/opioidinduzierte-obstipation/ (Zugriff: Mai 2025).
7 Bell, TJ et al. (2009). The prevalence, severity, and impact of opioid-induced bowel dysfunction: results of a US and European Patient Survey (PROBE 1). Pain Medicine; 10(1):35–42.
8 Coyne, KS et al. (2014). Opioid-induced constipation in patients with chronic noncancer pain in the USA, Kanada, Germany, and the UK: descriptive analysis of baseline patient-reported outcomes and retrospective chart review. Clinicoeconomics and Outcomes Research; 6:269–281.
9 Brock, C et al. (2012). Opioid-induced bowel dysfunction: pathophysiology and management. Drugs; 72(14):1847–1865.
10 Pergolizzi, JV Jr. et al. (2020). The Use of Peripheral μ-Opioid Receptor Antagonists (PAMORA) in the Management of Opioid-Induced Constipation: An Update on Their Efficacy and Safety. Drug Design, Development and Therapy; 14:1009–1025.
11 Gudin, J, Fudin, J (2020). Peripheral Opioid Receptor Antagonists for Opioid-Induced Constipation: A Primer on Pharmacokinetic Variabilities with a Focus on Drug Interactions. Journal of Pain Research; 13:447–456.
12 Hale M et al. (2017). Naldemedine versus placebo for opioid-induced constipation (COMPOSE-1 and COMPOSE-2): two multicentre, phase 3, double-blind, randomised, parallel-group trials. Lancet Gastroenterology Hepatology; 2(8): 555-564.
13 Katakami N et al. (2017). Randomized Phase III and Extension Studies of Naldemedine in Patients With Opioid-Induced Constipation and Cancer. Journal of Clinical Oncology; 35:3859-3866.
14 Farmer, AD et al. (2019). Pathophysiology and management of opioid-induced constipation: European expert consensus statement. United European Gastroenterology Journal; 7(1):7–20.
15 World Gastroenterology Organisation (WGO). https://www.worldgastroenterology.org/who-we-are (Zugriff: Mai 2025).
